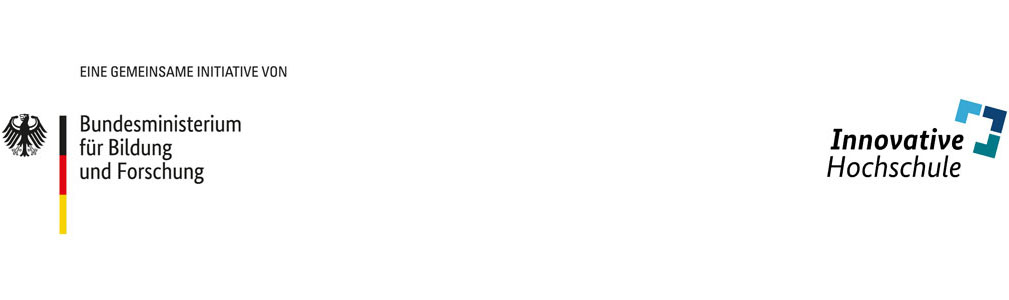Gesellschaftliches Engagement im historischen und kulturellen Wandel
Deutsche Sozialpolitik mit ihren staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren verweist auf die lange historische Tradition, die Ehrenamt, Philanthropie[1], Mäzenatentum und Stiftungskultur in Deutschland haben.
Schon im Mittelalter war es Adeligen und ehrenwerten Männern erlaubt, unbezahlte staatliche Ämter, etwa das des Laienrichters, zu übernehmen, um Anerkennung und Ehre zu erlangen. Durch die Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnten männliche, tadellose Bürger im Rahmen eines Ehrenamts im kommunalen Geschehen mitwirken – ein politisches Instrument, um Aufstände zu verhindern. Neben diesem staatlichen, stark administrativen Ehrenamt, das mit der Zeit an Attraktivität verlor, boten in dieser Zeit immer mehr gemeinnützige und karitative Vereinigungen wie auch Bürgerbewegungen die Möglichkeit sich gesellschaftlich zu engagieren (Enquete-Kommission, 2002; Peglow, 2002).
Die Augsburger Fuggerei, die unverschuldet in Not geratenen Menschen ein Heim bot, gehörte zu den ersten gemeinnützigen Initiativen, die von einer Privatperson gestiftet wurden. Mitte des 19. Jahrhunderts breitete sich gesellschaftliches Engagement in Form von bürgerlicher Wohltätigkeit weiter aus. Mit dem Einsetzen der Industrialisierung engagierten sich wohlhabende Bürger und Industrielle für die Arbeiterklasse und bemühten sich in kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Projekten deren Elend zu lindern. Dies schlug sich etwa in dem bis heute unerreichten Stiftungsboom während der Gründerzeit nieder. Angebote wie Wohnungsbau oder Krankenversicherungen stärkten gleichzeitig das Ansehen und den sozialen Status der Gönner (vgl. Hiß, 2009). Gleichzeitig bildeten sich Selbsthilfevereinigungen von Arbeitern. Im so genannten Elberfelder System, das immer mehr Städte übernahmen, institutionalisierten die Kommunen das soziale Ehrenamt in der öffentlichen Verwaltung, indem sie die männlichen Bürger in der ehrenamtlichen Armenpflege koordinierten. Darüber hinaus leistete die bürgerliche Frauenbewegung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ehrenamtliche Arbeit in der Wohlfahrtspflege und gab Frauen die Möglichkeit, sich außerhalb der Familie zu engagieren (Enquete-Kommission, 2002; Krimphove, 2005; Peglow, 2002).
Mit der Sozialgesetzgebung unter Bismarck übernahm zusammen mit den kirchlichen Verbänden der Staat die soziale Absicherung der Bürger und legte entsprechende Gesetze und Rahmenbedingungen fest. Damit waren die sozialen Leistungen nicht mehr von Nächstenliebe und der Willkür der Oberschicht abhängig, sondern erreichten zuverlässig alle Bürger. Gleichzeitig war dadurch die Eigenverantwortung der Bürger weniger gefordert. Den Unternehmern wurden Sozialversicherungsabgaben[2] abverlangt, die schnell als Zwangsleistung wahrgenommen wurden. Freiwillige bürgerschaftliche Initiativen wurden obsolet und gingen zurück.
In der Weimarer Republik entwickelte sich dann die duale Struktur aus öffentlichen und freien Trägern, die die Wohlfahrtspflege bis heute prägt. Viele Bereiche der Sozialarbeit konnten nicht mehr ausschließlich ehrenamtlich bewältigt werden und es entstanden eigenständige Berufe und professionelle Dienste. Je mehr Sozialleistungen von Staat und Wohlfahrtsverbänden[3] übernommen wurden, desto mehr professionalisierten und bürokratisierten sich diese. In der Folge verstanden die deutschen Bürger privat organisiertes gesellschaftliches Engagement als staatsunterstützend und -stabilisierend sowie an hierarchische Verbandsstrukturen gebunden (Enquete-Kommission, 2002). Immer weniger Bürger fühlten sich dazu angehalten, sich selbstorganisiert zu engagieren. Dies galt in ähnlicher Weise auch für die Bereiche der Kultur und Wissenschaft, aus denen sich die privaten Stifter, darunter viele Juden, im Zuge politischer Umwälzungen und Instabilität sowie damit verbundener ideeller Krisen zunehmend zurückzogen und ihre Einrichtungen in staatliche Hände gaben. Unter dem Regime der Nationalsozialisten fand schließlich eine Zwangsverstaatlichung statt (Krimphove, 2005).
Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchsen die Wohlfahrtsverbände enorm. Der Staat übertrug ihnen vermehrt öffentliche Aufgaben und Finanzmittel und griff dadurch immer mehr regulierend in die einst selbstorganisierten Interessenvertretungen ein. Bis heute sind Staat und gemeinnütziger Sektor in ihren organisatorischen und finanziellen Strukturen korporativ eng miteinander verwoben (Enquete-Kommission, 2002). Auch private Unternehmen sollten nach der Idee der „sozialen Marktwirtschaft“ in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gefordert und sich per Gesetz[4] für das öffentliche Wohl mit verantwortlich zeigen: Wirtschaftliches Wachstum und sozialer Ausgleich sollten Hand in Hand gehen (Backhaus-Maul & Braun, 2007; Hiß, 2009).
Mit der 68er-Bewegung wurde schließlich Kritik an der „Verstaatlichung der Nächstenliebe“ (Enquete-Kommission, 2002, S. 499) laut. Stieg der eigene Wohlstand in Zeiten des Wirtschaftswunders auch ohne große politische Beteiligung, wurde einer breiten Bevölkerung Mitte der 1970er Jahre bewusst, dass das hohe Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit allmählich zurückging und der Sozialstaat nicht alle sozialen Probleme lösen konnte. In neuer bürgerlicher Solidarität waren „unkonventionelle“ Engagementformen und direktdemokratische Mitwirkungsbestrebungen die Konsequenz. Einhergehend mit einem neuen Selbstbewusstsein und Selbstverständnis der Bürger, aktiv Verantwortung zu übernehmen und sich politisch einzumischen, schufen sie sich immer mehr eigene, oft flexiblere Strukturen mit flachen Hierarchien und informeller Organisation. Es entwickelte sich ein Engagement, das sich eigene Ziele setzte und die staatlichen Strukturen bewusst ablehnte und vermied. In einer Art „bürgergesellschaftliche[m] Aufbruch“ (ebd.) bildeten sich wieder Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen sowie neue lokale Frauen-, Ökologie-, Politik- und andere Alternativbewegungen. Der „Non-Profit-Bereich“ oder auch so genannte „Dritte Sektor“ entstand und gewinnt seitdem immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung (Anheier, 1999; Enquete-Kommission, 2002): In Abgrenzung zum Staat (Erster Sektor) und zur profitorientierten Marktwirtschaft (Zweiter Sektor) umfasst der Dritte Sektor den Handlungsbereich von Vereinen, Verbänden, Selbsthilfegruppen, Stiftungen und anderen selbstorganisierten, gemeinnützigen Interessensvertretungen. Im Dritten Sektor sind wirtschaftliche Ziele, staatliche Steuerung der Leistung sowie gemeinschaftliche Erwerbsarbeit miteinander verwoben, jedoch ohne dass einer dieser Mechanismen überwiegt (Bundeszentrale für politische Bildung 2011; Schönhuth, 2005).
Parallel zum Ersten und Dritten Sektor findet gesellschaftliches Engagement heute auch im Zweiten Sektor statt. Die Gemeinwohlorientierung von Unternehmern, die schon zu Zeiten der Industrialisierung ihren Anfang fand und zunächst unter Bismarck und dann Adenauer institutionalisiert wurde, erfolgt mittlerweile zunehmend explizit als eigene freiwillige Angelegenheit von Unternehmen (Backhaus-Maul & Braun, 2007; Hiß, 2009). Unternehmen engagieren sich für die Gesellschaft und investieren gemäß ihrer „Corporate Social Responsibility“ (CSR) in verantwortliches unternehmerisches Handeln, das über gesetzliche Vorgaben hinausgeht. Sie berücksichtigen in ihrer Unternehmenstätigkeit wie auch in Bezug auf ihre Stakeholder[5] soziale, ethische und ökologische Belange. Dabei kalkulieren sie positive Effekte für die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens bewusst ein (vgl. Backhaus-Maul & Braun, 2007; Europäische Kommission, 2011). Ein weiterer weit verbreiteter Begriff ist „Corporate Citizenship“ (CC): freiwilliges, über das eigentliche Kerngeschäft des Unternehmens hinausgehendes Engagement für gesellschaftliche Belange. Hier bringen sich Unternehmen als „gute Bürger“ in das Gemeinwesen ein und unterstützen oder initiieren gemeinnützige Projekte, indem sie durch Geld und Sachmittel sowie Zeit, Kompetenz und Netzwerke ihrer Mitarbeiter (vgl. Backhaus-Maul & Braun, 2007). Gerade in den letzten Jahren hat der Begriff des “Social Entrepreneurships” an Popularität gewonnen. Sozialunternehmer zeichnen sich dadurch aus, dass sie gesellschaftliche Probleme durch unternehmerisches Handeln lösen. Sie verbinden das klassische „Geschäft“ des Dritten Sektors aus Spenden, Fundraising und Fördermitteln mit der Gründung von Organisationen, die innovative Lösungen für gesellschaftliche Probleme bieten (Berthold, Brandenburg, Apelt & Platt, 2010). Die individuelle bürgerliche Mitwirkung an der Gesellschaft spielt sich dabei nicht nur innerhalb der Strukturen des Dritten Sektors ab, die Übergänge zum Ersten und Zweiten Sektor sind oft fließend.
Fazit und Ausblick. Die Formen gesellschaftlichen Engagements haben sich im Laufe der Geschichte mehrmals gewandelt. Zum einen veränderten sich aufgrund von Wertewandel und flexiblerer Lebensentwürfe die Motivationen für und Ansprüche an gesellschaftliches Engagement bei den Bürgern selbst. Zum anderen hat in den vergangenen Jahrzehnten die Politik bürgerschaftliches Engagement für sich entdeckt. Nicht zuletzt gewinnt gesellschaftliches Engagement im Kontext der Bürgergesellschaft, in der der Bürger als aktives Mitglied eines demokratischen Gemeinwesens gefordert ist, auch in wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen an Bedeutung. Hier lohnt sich ein differenzierter Blick auf die Begrifflichkeiten, die in Zusammenhang mit Engagement Verwendung finden.