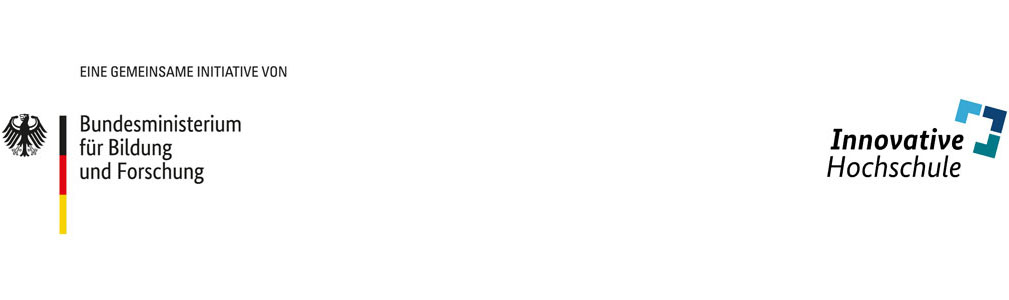Einfluss von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
Der Staat geriet Mitte der 1970er aufgrund der vielen Aufgaben, die er übernommen hatte, immer mehr an seine Grenzen. Die komplexen staatlichen Sicherungssysteme brachten vermehrt Ökonomisierung, Verrechtlichung und Bürokratie mit sich. Der nachlassende Aufschwung und die höhere Arbeitslosigkeit schwächten staatliche Sozialleistungen, die an Steuern und damit Erwerbsarbeit gebunden sind. Das Leitbild des ganzheitlichen Versorgungsstaates bröckelte. Globalisierung, Europapolitik und nicht zuletzt das Ende der DDR stellten die deutsche Politik vor große, gerade finanzielle Herausforderungen. Die Ansprüche an Umfang und Qualität öffentlicher Leistungen aber blieben.
So wurden Ende der 1990er Jahre quer durch alle politischen Lager verschiedene Konzepte eines „aktivierenden“ und „ermöglichenden“ Staates zum Programm. Ziel war eine „gleichberechtigte Wechselbeziehung“ (Enquete-Kommission, 2002, S. 506) zwischen Staat und bürgergesellschaftlichen Akteuren – Bürgern wie Organisationen – bei der Bewältigung öffentlicher Aufgaben. Ein Mittelweg zwischen allumfassendem Versorgungsstaat und Minimalstaat, der sich möglichst weit zurückzieht und die Gesellschaft sich selbst regulieren lässt. Der Staat soll in einer strategischen Rolle geeignete Rahmenbedingungen schaffen, in der die Bürger aktiviert, in ihrem zivilen und sozialen Verantwortungsbewusstsein gestärkt und zu gesellschaftlichem Engagement ermutigt werden. Menschen ohne Erwerbsarbeit können ins gesellschaftliche Leben integriert werden und von der erlebten Sinnhaftigkeit gemeinschaftsbezogener Arbeit profitieren. Der Bürger sollte mehr an (sozial)politischen Entwicklungen beteiligt und der Sozialstaat gleichzeitig leistungsfähiger werden (Enquete-Kommission 2002).
Die zuvor zitierte Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, die der deutsche Bundestag 1999 einsetzte, um eine Bestandsaufnahme bürgerschaftlichen Engagements vorzunehmen und Handlungsempfehlungen für dessen Förderung zu erarbeiten, ist ein prominentes Beispiel dafür, dass sich die Politik zunehmend mit dem Thema befasst. Auch die Europäische Kommission rief bereits 1996 den Europäischen Freiwilligendienst ins Leben und erklärte das Jahr 2011 zum „Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit zur Förderung der aktiven Bürgerschaft“ (Europäische Kommission, 2011). Ziele waren gesellschaftlichem Engagement mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zukommen zu lassen sowie durch verbesserte Strukturen den Zugang und die Vernetzung zwischen den Beteiligten und Interessierten zu erleichtern.[9]
Das deutsche Familien-, Finanz- und Innenministerium sowie die Länderregierungen schaffen vermehrt Gesetze, Fördermaßnahmen und konkrete Anreizsysteme[10]: Auf finanzieller Ebene sind dies unter anderem höhere Pauschalen im Sport, Kultur- und Umweltbereich sowie in der politischen Bildung, die Übernahme von Unfall- und Haftpflichtversicherungen durch die Vereine und Organisationen, steuerliche Vergünstigungen oder die Ehrenamtskarte[11], durch die in einigen Bundesländern gesellschaftlich Engagierte in ihrer Gemeinde Vergünstigungen in Anspruch nehmen können. Auf gesetzlicher Ebene gab es beispielsweise Reformen im Stiftungsrecht, beim bürgerschaftlichen Engagement von Arbeitslosen und im Spendenrecht. Durch den Ausbau von Freiwilligendiensten, dem „Kompetenznachweis für Ehrenamt und Freiwilligenarbeit“[12] oder der Freistellung von Engagierten vom Hauptberuf für einige Arbeitstage zeigt der Staat, wie wertvoll und förderungswürdig gesellschaftliches Engagement ist. Diese Anreizstrukturen schlagen sich auch im Dritten Sektor nieder: Zahlreiche Stiftungen, selbst Akteure für das Gemeinwohl, unterstützen ihrerseits auch das bürgerschaftliche Engagement Dritter, beispielsweise im Forschungs- oder Bildungsbereich (vgl. Bundesverband Deutscher Stiftungen & Körber-Stiftung, 2010).
Fazit und Ausblick. Wie zuvor dargestellt wurden in den letzten Jahren zahlreiche Anreize geschaffen, um gesellschaftliches Engagement durch die Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen zu stärken. Aner (2006) erforschte in einer Studie[13] der Wechselwirkung von individuellen Motiven und strukturellen Rahmenbedingungen. Sie ging der Frage nach, wie unter Bedingungen befriedigender Lebenslagen zivilgesellschaftliches Engagement entsteht und aus welchen biografischen Gründen Menschen trotz befriedigender Lebenslagen passiv bleiben. Sie stellt heraus, dass individuelle positive Partizipationserfahrungen einen entscheidenden Faktor für das Engagementpotenzial des Einzelnen darstellen. Weder materielle Umstände im vorberuflichen Kontext, die besuchte Schulform noch Vereinsmitgliedschaften sind maßgebend für die Herausbildung gesellschaftlichen Engagements, sondern „die Möglichkeiten der Partizipation im Sinne einer subjektiv als gleichberechtigt empfundenen gesellschaftlichen Teilhabe“ (Aner, 2006, S. 6). Erfahrungen von Ohnmacht und Ausgrenzung führen tendenziell zu Resignation und Passivität und verhindern gesellschaftliche Mitwirkung. Jenseits von Symbolpolitik kommt hier der Gestaltung von förderlichen Rahmenbedingungen für gesellschaftliches Engagement eine wichtige Rolle – insbesondere in Bildungseinrichtungen – zu.